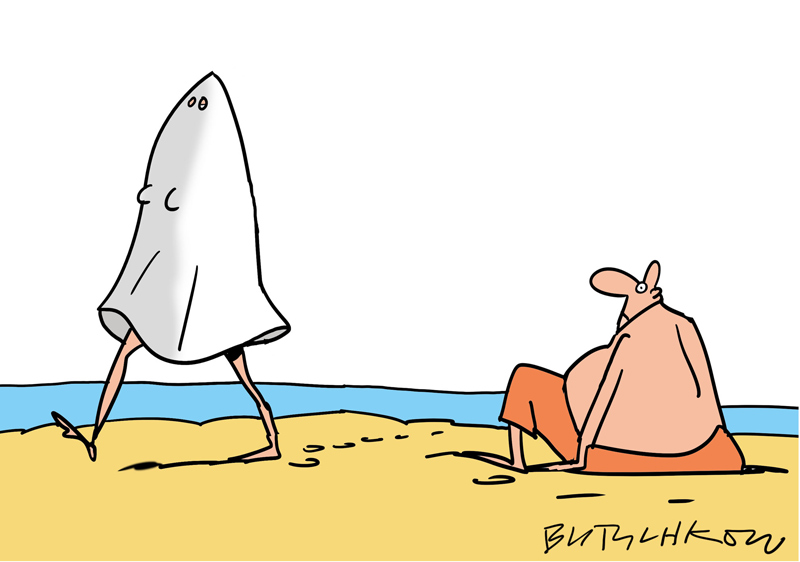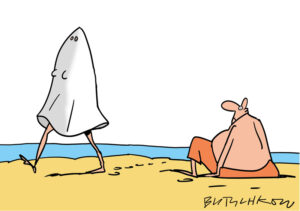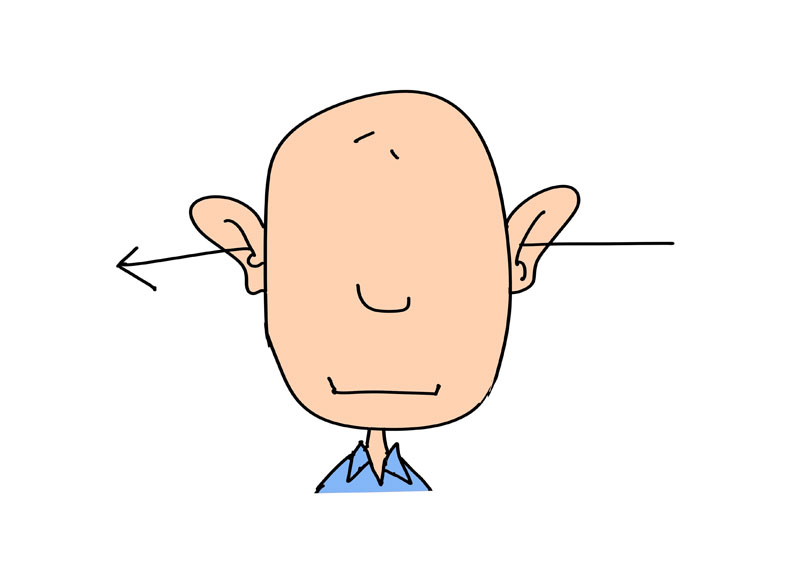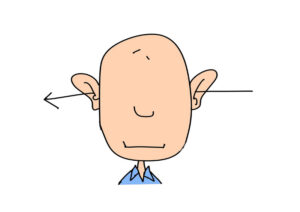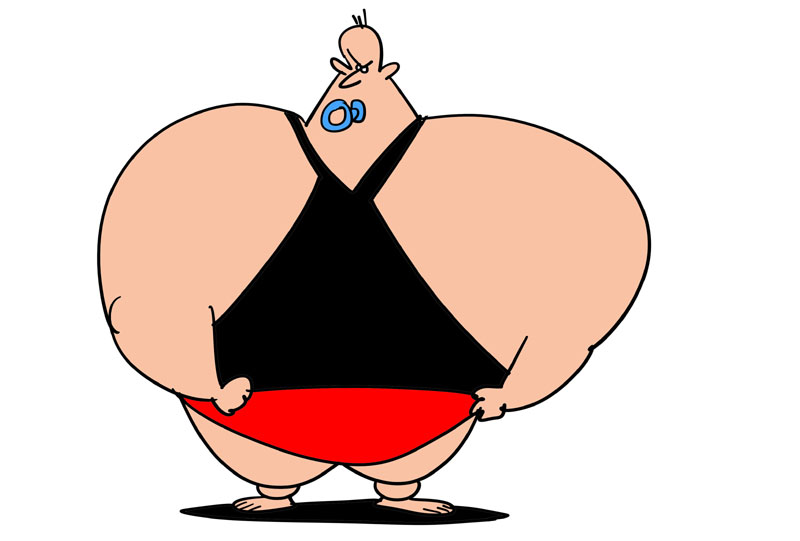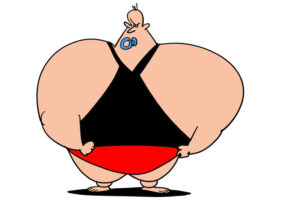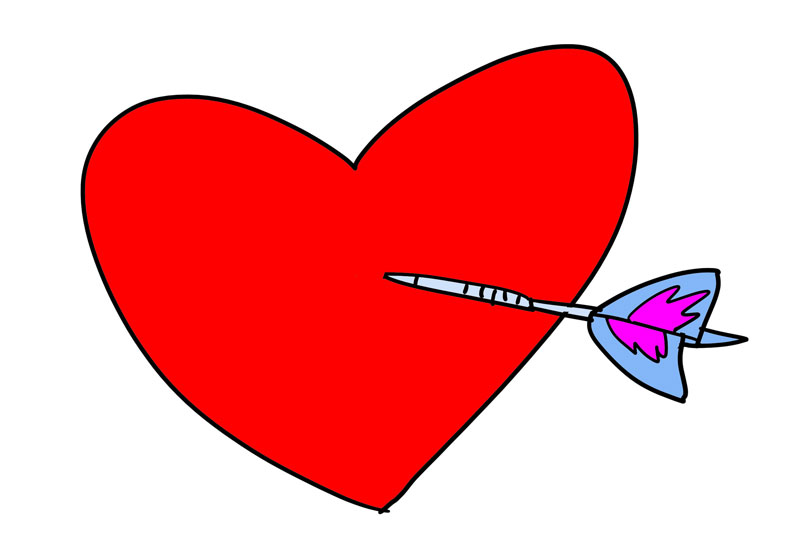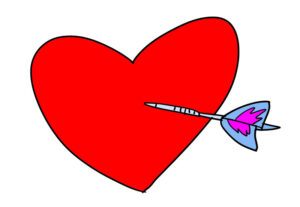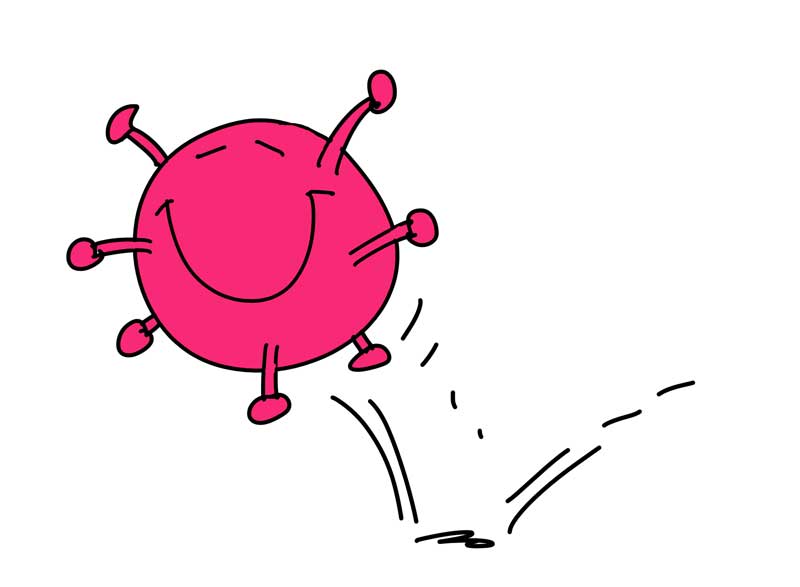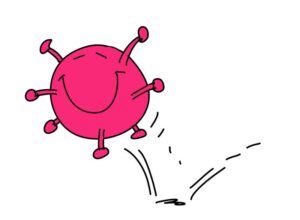Er war ein schlanker, mittelgroßer Typ, trug einen Bart und eine Frisur wie Jimi Hendrix und stand immer vor einer Staffelei mit einer weißen Leinwand. Sein Name war Bob Ross. Er starb 1995. Man kann seine Filmchen heute noch im Netz bewundern. Da er Englisch sprach, verstanden ihn eher nur die angelsächsischen Zuschauer, was aber auch völlig egal war, denn der Klang seiner warmen, ruhigen Stimme stimmte jeden, egal welchen Geschlechtes und welcher Nationalität, darauf ein, die Angst vor einer weißen Leinwand für immer abzustreifen.
Er war ein schlanker, mittelgroßer Typ, trug einen Bart und eine Frisur wie Jimi Hendrix und stand immer vor einer Staffelei mit einer weißen Leinwand. Sein Name war Bob Ross. Er starb 1995. Man kann seine Filmchen heute noch im Netz bewundern. Da er Englisch sprach, verstanden ihn eher nur die angelsächsischen Zuschauer, was aber auch völlig egal war, denn der Klang seiner warmen, ruhigen Stimme stimmte jeden, egal welchen Geschlechtes und welcher Nationalität, darauf ein, die Angst vor einer weißen Leinwand für immer abzustreifen.
Dafür brauchte es nur eine Palette, Farben, Pinsel, Spachtel – und ein „Here we go!“ Bob, ein Großmeister der Landschaftsmalerei, begann sein Werk, getreu der malerischen Grundregel von Vordergrund und Hintergrund, zuerst von oben – und zwar mit dem Himmel. Dafür benutzte er einen Breitpinsel, solchen, wie ihn die Maler zum Streichen von Haustüren benutzen, erklärte fröhlich „Now a little bit blue for the sky“, und klatschte querrüber ein Blau auf die erschrockene Leinwand, die eher ein verzagtes Herangehen gewohnt war und mit so einem massiven Angriff nicht gerechnet hatte. Sodann drückte er einen Strang Weiß aus der Tube auf die Palette, schmierte sich davon etwas auf einen Spachtel und begann damit wunderschöne Wolken anzusetzen. Alles sah so spielerisch leicht aus, dass man sich fragte, warum man nicht längst selber auf die Idee gekommen war, in dieser lockeren Technik regelmäßig zur Entspannung Wolkenhimmel zu malen?
Mit dem angefeuchteten Breitpinsel fuhr er dann quer über seine gemalten Flächen und verlieh ihnen dadurch mehr und mehr wolkige Leichtigkeit. Unglaublich. Danach watschte er zackig den Pinsel – rechts – links – rechts – links – rechts – links – an der unteren Verstrebung seiner Staffelei ab, um ihm damit das Wasser aus den Haaren zu klopfen. Die Kameraeinstellung zeigte Bob in seinem blütenweißen, makellosen Hemd nur bis zum Gürtel, man konnte also nur vermuten, wie vollgesaut seine Hose und der Boden war.
„Here we go“ – schon entstanden aus anfänglich plumpen Zacken und Kanten, die er vorher hemmungslos mitten in den zarten, verletzlichen Himmel geschmiert hatte, plötzlich grandiose Bergmassive. Wahnsinn! Und wieder trug er auf diese Idylle mit dem Spachtel quer einen dreisten, fetten Streifen Dunkelblau auf. Wäre da nicht diese wohlige Stimme, die einem tiefstes Vertrauen in seine Malkunst vermittelte, man hätte sich sie Haare gerauft und gedacht: Oh my god, was tust du da, Unseliger? Aber der hässliche Balken entwickelte sich rasch zu einem kristallklaren Bergsee. Bob wusste genau was er tat, aber er war noch nicht fertig. Nun tupfte er virtuos mit einem Fächerpinsel („Totally crazy“) endemische Baumarten um das Seeufer, die er sich anschließend naturgetreu auf der Seeoberfläche spiegeln ließ. Genial! Ein paar Felsen obendrein, etwas Wiesen – und fertig war das amerikanische Nationalparkpanorama.
Figürliches, also schnüffelnde Grizzlys, malmende Elche oder jagende Ureinwohner, sah man auf Bobs Bildern eher nicht. Wie kitschig man seine Bilder auch finden mag, handwerklich sind sie grundsolide, eine Motivation für Millionen Menschen, Bilder zu malen – und ein glänzender Umsatz für die Malartikelhersteller. Letzte Woche erhielt ich eine Einladung meiner Nachbarin zu ihrer Vernissage „Blumen am Zierteich“. Immerhin.
 Um den Tannenbaum lag dieses Jahr weniger als sonst. Ist doch klar, es fehlten ja drei Haushalte und der Weihnachtsmann durfte als Mitglied einer Risikogruppe auch leider nicht dabei sein. Die Nordmanntanne war mit Coronakugeln und kleinen, maskierten Engelchen geschmückt und schimmerte festlich. Um 18:47 Uhr brachte ein Kurierfahrer noch die letzten drei Amazon-Pakete, dann endlich konnte die Bescherung losgehen. Eingeleitet wurde sie von der kleine Coco mit dem Quarantäne-Gedicht „Markt und Straßen steh´n verlassen, alles sieht so ängstlich aus. Ach, was für eine Freude. Harald bekam die gesamte Staffel von „Der Herr der Viren“ mit Christian Drosten und Tante Katja einen neuen Aluhut. Über den prächtigen Bildband „Die großen Pandemien“ und die Büste von Jens Spahn freute sich Mutti riesig und Onkel Karl war begeistert als wir ihm den Fotokalender „Karl Lauterbach in Talkshows“ überreichten.
Um den Tannenbaum lag dieses Jahr weniger als sonst. Ist doch klar, es fehlten ja drei Haushalte und der Weihnachtsmann durfte als Mitglied einer Risikogruppe auch leider nicht dabei sein. Die Nordmanntanne war mit Coronakugeln und kleinen, maskierten Engelchen geschmückt und schimmerte festlich. Um 18:47 Uhr brachte ein Kurierfahrer noch die letzten drei Amazon-Pakete, dann endlich konnte die Bescherung losgehen. Eingeleitet wurde sie von der kleine Coco mit dem Quarantäne-Gedicht „Markt und Straßen steh´n verlassen, alles sieht so ängstlich aus. Ach, was für eine Freude. Harald bekam die gesamte Staffel von „Der Herr der Viren“ mit Christian Drosten und Tante Katja einen neuen Aluhut. Über den prächtigen Bildband „Die großen Pandemien“ und die Büste von Jens Spahn freute sich Mutti riesig und Onkel Karl war begeistert als wir ihm den Fotokalender „Karl Lauterbach in Talkshows“ überreichten.