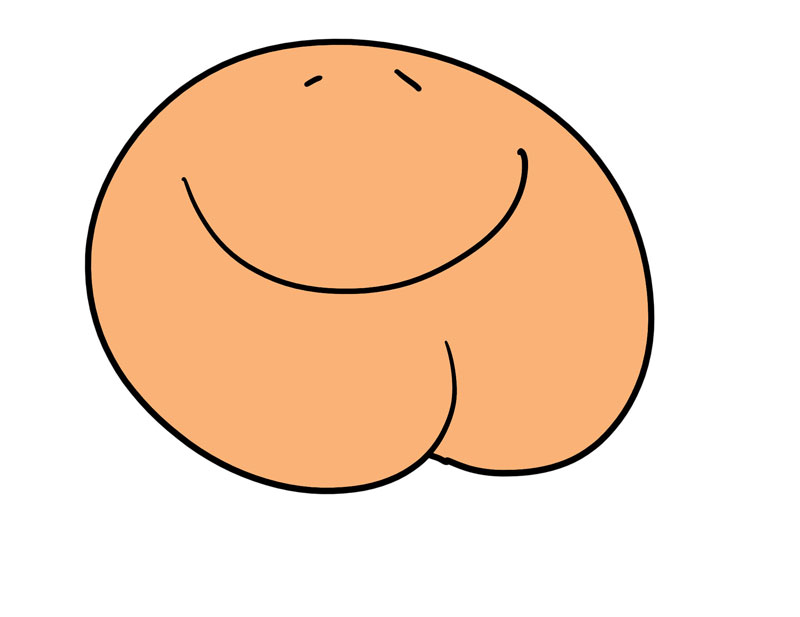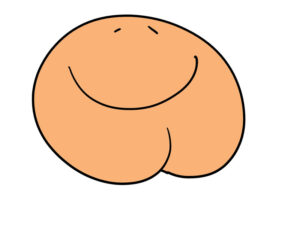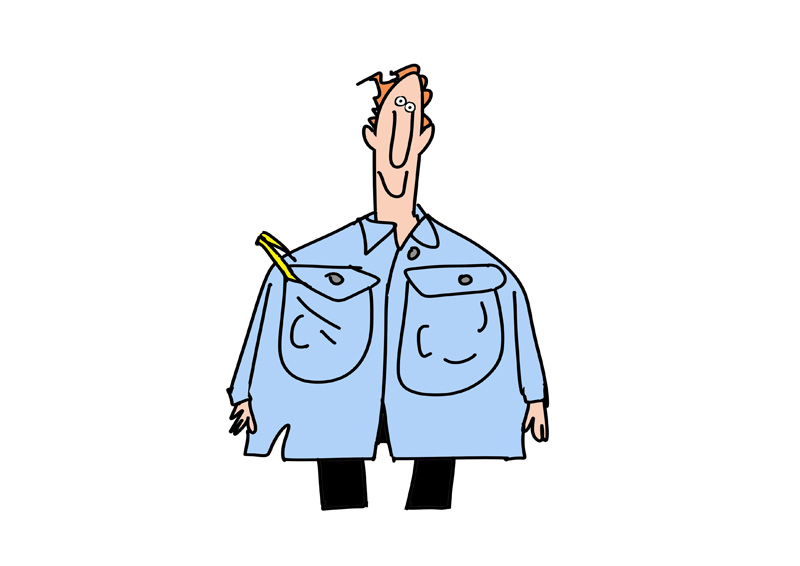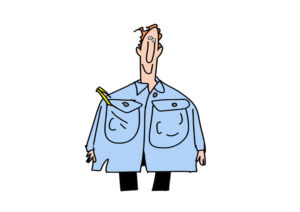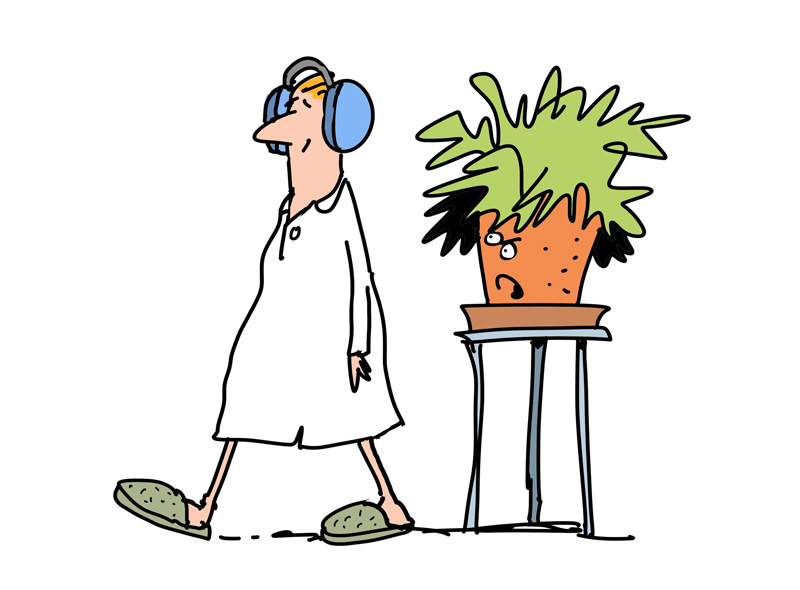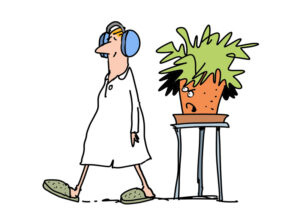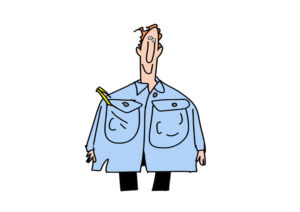 Einkaufspassagen stehen bei mir auf der Hass-Skala gleich hinter Badestrand, aber es hilft nix, ich brauche dringend mal wieder ein neues Hemd. Also betrete ich mit tiefer Abscheu einen dieser Konsumtempel. Von leiser Musik umspült schleiche ich missmutig an blitzeblanken Glasfassaden vorbei und versuche in dem Meer von Stoffen und Farben ein Signal meines Wunschhemdes zu erhaschen. Warum habe ich immer den Eindruck, dass in allen Boutiquen das Gleiche hängt? Irgendwann hole ich tief Luft und schreite durch die verlockend weit geöffnete Pforte eines Ladens. Scheu streiche ich in an Hemdenkollektionen vorbei, begrapsche dieses und jenes Hemd – und weiß nicht. „Kann ich Ihnen helfen?“, fragt eine Verkäuferin. Lass mich in Ruhe, du blöde Kuh, denke ich und sage: „Danke, sehr freundlich, ich schau mich nur um.“ „Schauen Sie sich nur um“, wiederholt sie. „Nur mal umschauen“, bekräftige ich und blättere durch eine Reihe einfarbiger Hemden. Ups, denke ich, das könnte was sein. Hellgrau, XL, flauschiger Stoff. Ich liebe warme Hemden. „Ziehen Sie´s doch mal an“, meint sie.
Einkaufspassagen stehen bei mir auf der Hass-Skala gleich hinter Badestrand, aber es hilft nix, ich brauche dringend mal wieder ein neues Hemd. Also betrete ich mit tiefer Abscheu einen dieser Konsumtempel. Von leiser Musik umspült schleiche ich missmutig an blitzeblanken Glasfassaden vorbei und versuche in dem Meer von Stoffen und Farben ein Signal meines Wunschhemdes zu erhaschen. Warum habe ich immer den Eindruck, dass in allen Boutiquen das Gleiche hängt? Irgendwann hole ich tief Luft und schreite durch die verlockend weit geöffnete Pforte eines Ladens. Scheu streiche ich in an Hemdenkollektionen vorbei, begrapsche dieses und jenes Hemd – und weiß nicht. „Kann ich Ihnen helfen?“, fragt eine Verkäuferin. Lass mich in Ruhe, du blöde Kuh, denke ich und sage: „Danke, sehr freundlich, ich schau mich nur um.“ „Schauen Sie sich nur um“, wiederholt sie. „Nur mal umschauen“, bekräftige ich und blättere durch eine Reihe einfarbiger Hemden. Ups, denke ich, das könnte was sein. Hellgrau, XL, flauschiger Stoff. Ich liebe warme Hemden. „Ziehen Sie´s doch mal an“, meint sie.
Oh, wie ich auch das hasse. Enge Kabine, ausziehen, die Klamotten linkisch über einen Haken wurschteln, das neue Teil anziehen, raustreten und in einen Spiegel schauen. Alle anderen Anwesenden im Geschäft glotzen auch und begutachten unaufgefordert meine Wahl. Sucht euch gefälligst euer eigenes Hemd, ihr Affen. „Na, das passt doch“, sagt die Verkäuferin. „Im Prinzip schon…aber das sind doch keine Taschen“, sage ich und stochere demonstrativ mit meinen Fingern in den beiden fipsigen Brusttaschen herum. „Viel zu klein“, ergänze ich, „da bekomme ich doch keine Brille und keinen Kugelschreiber rein.“ Eigentlich kann man dieser fundierten Kritik nichts entgegensetzen. Irrtum. „Ich bitte Sie, das sind doch nur Accessoires“, sagt sie spitz. Offenbar bin ich einer der Letzten einer aussterbenden Spezies, die in die Taschen ihrer Hemden etwas hineinstecken möchte? Wie pervers bin ich denn? „Accessoires?“, frage ich noch mal nach. „Nur Accessoires“, spricht sie noch einen Hauch französischer, „eine Zierde.
Wenn überhaupt was reinstecken, dann nur für Kleinigkeiten.“ Zum Beispiel?“, will ich wissen. Sie holt tief Luft: „Nun, also…“. „Büroklammern?“, unterbreche ich sie, „oder vielleicht einen Hustenbonbon?“ Sie flötet gereizt: „Wie Sie meinen.“ Ich gebe nicht auf: „Hat nicht der Erfinder der Brusttaschen sie genau deswegen erfunden, damit man etwas hineinstecken kann?“. „Dafür gibt es ja Rucksäcke“, antwortet sie spitz. Ich kontere: „Wer trägt denn seine Brille im Rucksack?“. „Ich brauche keine Brille.“ „Sie sollen das Hemd ja auch nicht kaufen“, entfährt es mir. Ihre Lippen werden ganz schmal. „Schauen Sie“, sage ich, zeige auf die beiden großen Taschen auf meiner Brust und mime den Crocodile Dundee, „das ist ein Hemd! Da geht alles rein. Links Brille und FFP2-Maske, rechts Kugelschreiber, Filzschreiber und Diktiergerät.“ „Und der Regenschirm? Kein Platz mehr?“, fragt sie giftig. Angefixte Frauen können richtig witzig sein.
 Vor einiger Zeit sprach mich Frau Hansen, meine Nachbarin, an. Als ältere, allein lebende Dame und mache sie sich Sorgen, dass keiner merken würde, „wenn mit mir mal was passiert ist“. Eine Bekannte sei unlängst gestürzt und hätte zwei Tage hilflos in ihrer Wohnung gelegen, bevor sie jemand gefunden habe. „Sollten meine Vorhänge im Schlafzimmer bis 9:30 Uhr nicht aufgezogen sind, dann stimmt etwas nicht mit mir“, sagte sie zu mir. „Eine gute Idee, dann weiß ich Bescheid“, antwortete ich. Drei Monate später schaue ich an einem Samstagmittag zufällig zu ihrem Haus herüber und sehe, dass ihre Vorhänge noch zugezogen sind. Eine Viertelstunde später rücken Polizei, Feuerwehr, Notarzt, das Technische Hilfswerk, ein Minenräum-kommando und – für den Fall einer Geiselnahme – das SEK an. Die Einheit stürmt das Haus und sichert dem Bereitschaftsarzt den Zugang zur Zielperson. Sanitäter tragen die festgeschnallte, medizinisch notversorgte Frau Hansen auf der Trage zum Krankentransporter. Am späten Morgen klopft sie putzmunter an meine Tür, reicht mir einen selbstgebackenen Kuchen und bedankt sich herzlich: „Wie beruhigend, so einen aufmerksamen Nachbarn zu haben.“ Ihr sei überhaupt nichts passiert, sie wollte mich nur mal testen.
Vor einiger Zeit sprach mich Frau Hansen, meine Nachbarin, an. Als ältere, allein lebende Dame und mache sie sich Sorgen, dass keiner merken würde, „wenn mit mir mal was passiert ist“. Eine Bekannte sei unlängst gestürzt und hätte zwei Tage hilflos in ihrer Wohnung gelegen, bevor sie jemand gefunden habe. „Sollten meine Vorhänge im Schlafzimmer bis 9:30 Uhr nicht aufgezogen sind, dann stimmt etwas nicht mit mir“, sagte sie zu mir. „Eine gute Idee, dann weiß ich Bescheid“, antwortete ich. Drei Monate später schaue ich an einem Samstagmittag zufällig zu ihrem Haus herüber und sehe, dass ihre Vorhänge noch zugezogen sind. Eine Viertelstunde später rücken Polizei, Feuerwehr, Notarzt, das Technische Hilfswerk, ein Minenräum-kommando und – für den Fall einer Geiselnahme – das SEK an. Die Einheit stürmt das Haus und sichert dem Bereitschaftsarzt den Zugang zur Zielperson. Sanitäter tragen die festgeschnallte, medizinisch notversorgte Frau Hansen auf der Trage zum Krankentransporter. Am späten Morgen klopft sie putzmunter an meine Tür, reicht mir einen selbstgebackenen Kuchen und bedankt sich herzlich: „Wie beruhigend, so einen aufmerksamen Nachbarn zu haben.“ Ihr sei überhaupt nichts passiert, sie wollte mich nur mal testen.