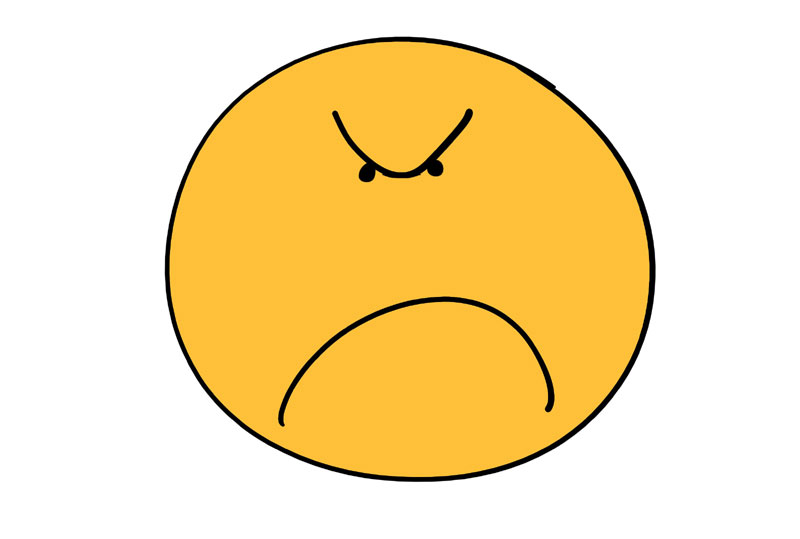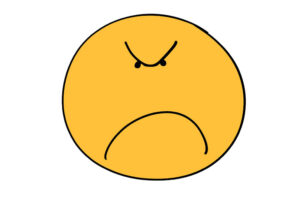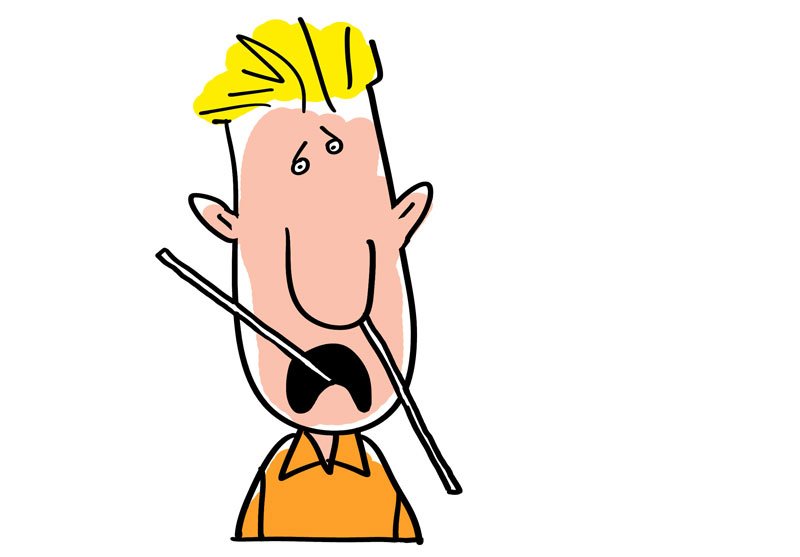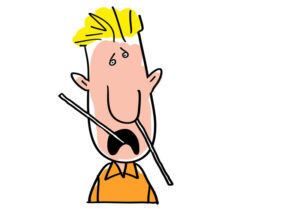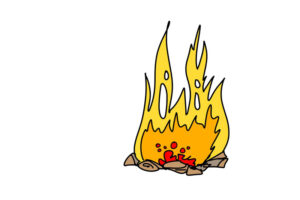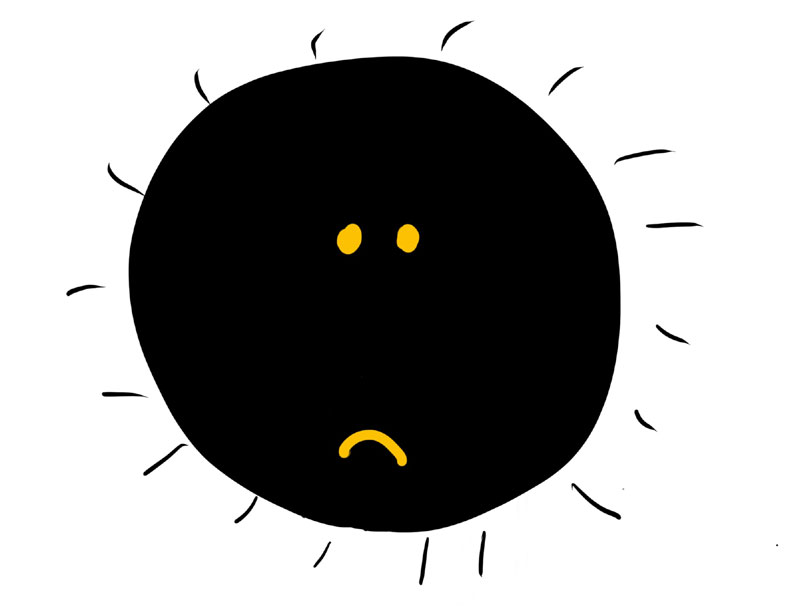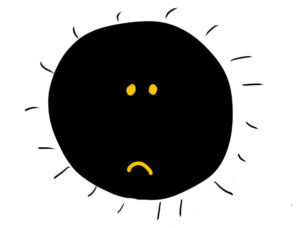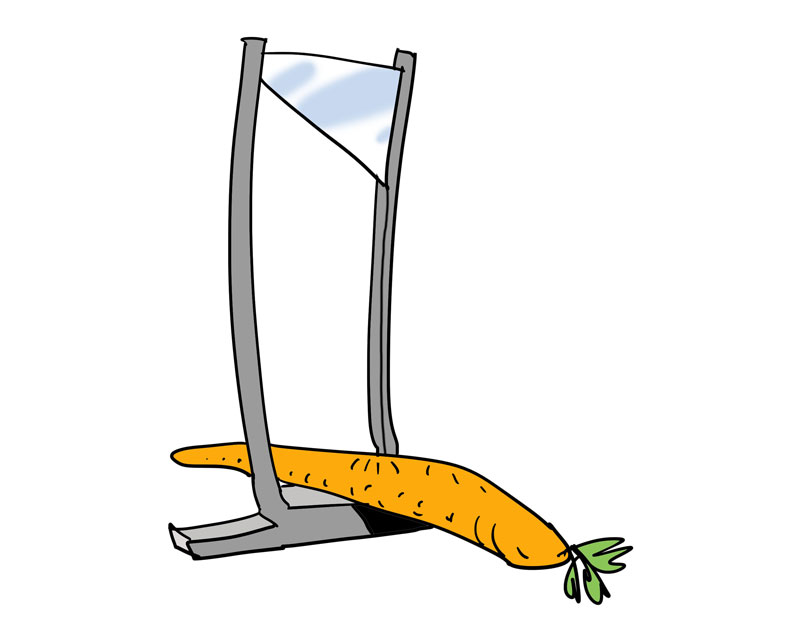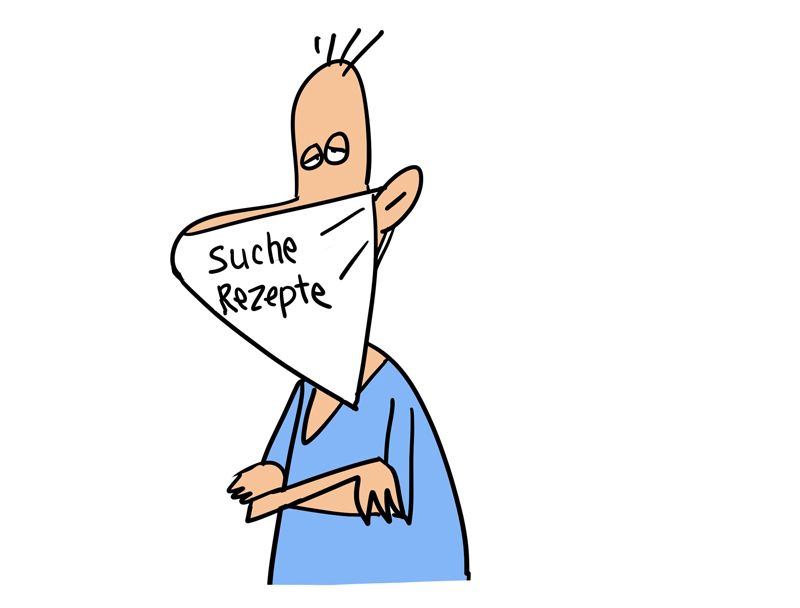Die Geschichte des Weihnachtsmannes
 Der Weihnachtsmann heißt eigentlich Matti Heikkinen und wurde in einem kleinen Dorf nahe Helsinki geboren. Sein Vater war Rentierzüchter und seine Mutter arbeitete in einer Fischfabrik als Schuppenflechterin.
Der Weihnachtsmann heißt eigentlich Matti Heikkinen und wurde in einem kleinen Dorf nahe Helsinki geboren. Sein Vater war Rentierzüchter und seine Mutter arbeitete in einer Fischfabrik als Schuppenflechterin.
Sein Talent zum weltweit berühmtesten Geschenkkurier war anfangs gar nicht zu erkennen. Der kleine Matti rodelte wie alle Kinder am liebsten mit seinem Schlitten das elterliche Dach herunter und fuhr auf den Tränenbächen seiner von ihrer Ehe frustrierten Mutter Schlittschuhe. Hin und wieder half er seinem Vater beim Kastrieren der Rentierbullen oder seiner Oma beim Einbringen der vereisten Wäsche. In der Schule störte er durch ständige Zwischenrufe, wie „Ho-ho-ho!“ oder „Wart ihr denn alle schön brav?“. Gute Pädagogen hätten da allerdings schon erkennen können, welches Talent in dem kleinen Matti schlummerte.
Der studierte also erst mal Walgesang und tourte mit der Gruppe „Fishermans Friend“ über die finnischen Dörfer bis er am Heiligen Abend 1847 bei einem Auftritt von einer indigenen Verehrerin ein in Geschenkpapier eingewickelten Brathering zugeworfen bekam. Das berührte Matti dermaßen, dass er in diesem Moment die Idee hatte, dieses Gefühl der Dankbarkeit allen Menschen zuteil werden zu lassen. Er ließ sich die Haare weiß färben, einen langen Bart wachsen und von der berühmten finnischen Mode-Ikone Supi Klamottinnen einkleiden. Die wählte ein kräftiges Rot, an Hals, Ärmeln und Mütze weiß abgesetzt, und kreierte damit dass weltweit berühmte Outfit des berühmten Geschenkkuriers.
Fortan beglückte Matti am Heiligen Abend als „Weihnachtsmann“ Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Irgendwann investierte er in einen Schlitten und sechs zugkräftige Rentiere, anders war das auch gar nicht mehr zu schaffen. Seine Anträge auf Ruhestand werden alljährlich mit der Begründung abgelehnt, dass er eine „systemrelevante“ Persönlichkeit sei und für die Gesellschaft schlicht unverzichtbar. Ein Ende seiner erfolgreichen Karriere steht also in den Sternen. Das ist die wahre Geschichte des Weihnachtsmannes. Hätte man nicht gedacht, oder?