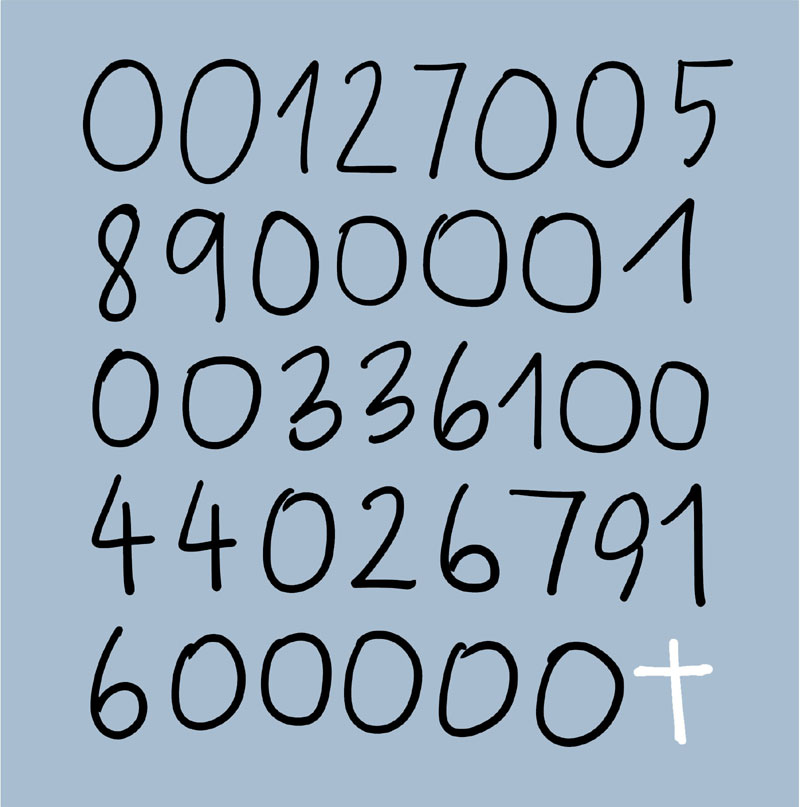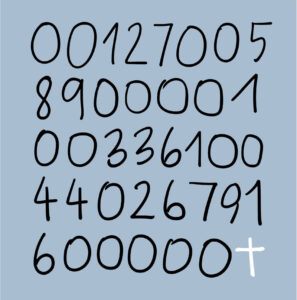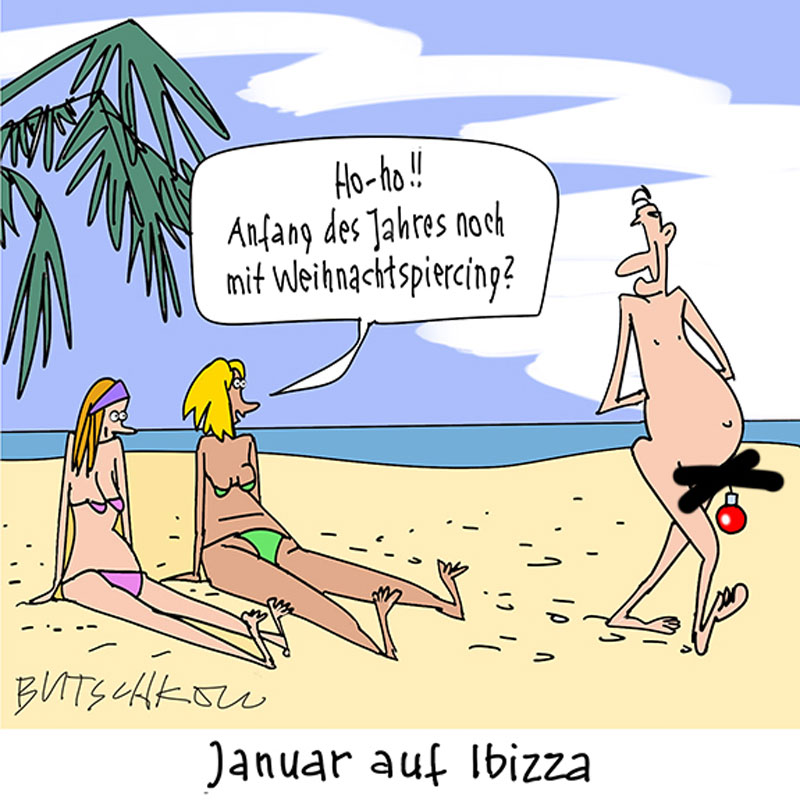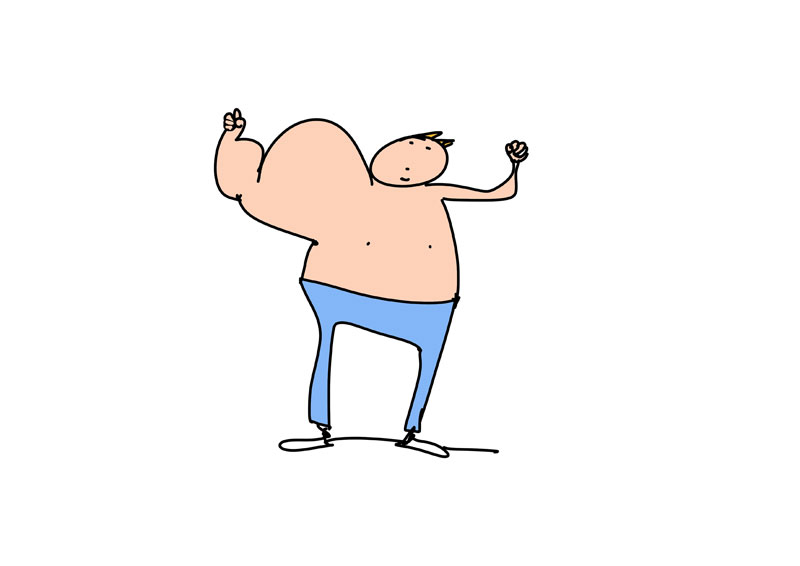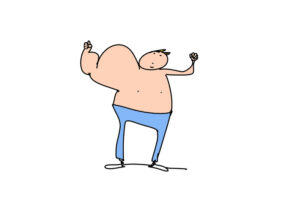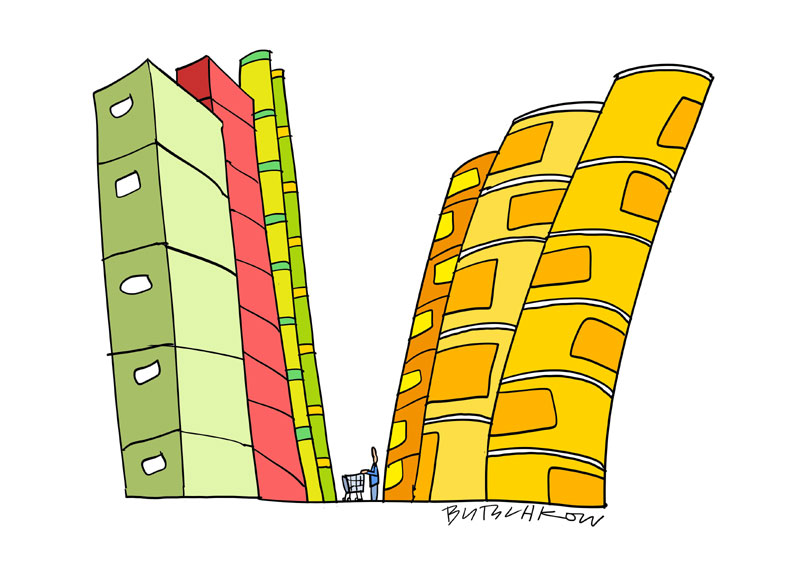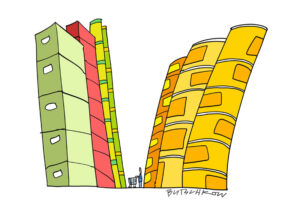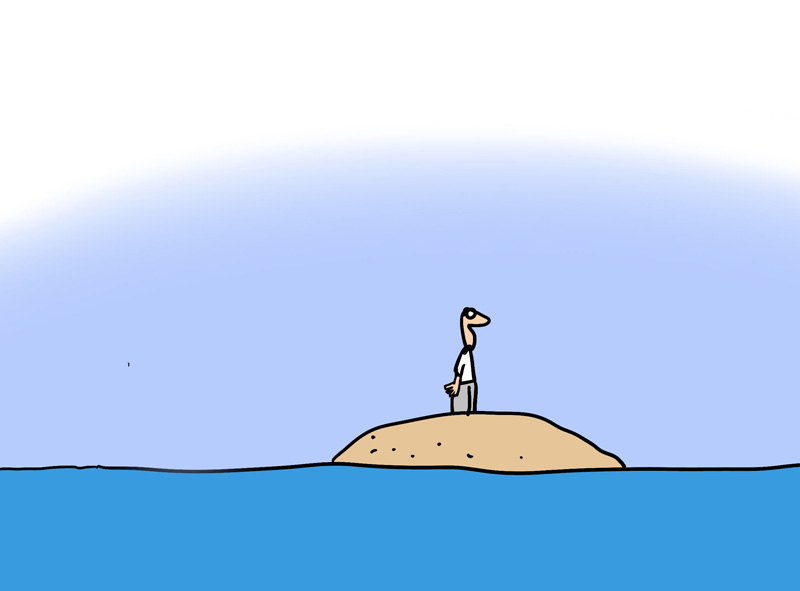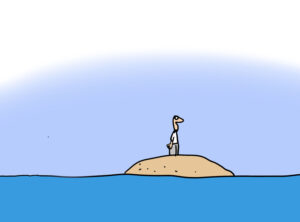Schmeckt´s denn?
 Theorie ist der Träumer, die Praxis die Realität. Sie offenbart gnadenlos alle Irrtümer und Selbstüberschätzungen und bringt Illusion und Wahrheit oft schmerzhaft ins Gleichgewicht. Will sagen, so lange man etwas nicht selber erfahren oder getan hat, kann man es viel weniger beurteilen.
Theorie ist der Träumer, die Praxis die Realität. Sie offenbart gnadenlos alle Irrtümer und Selbstüberschätzungen und bringt Illusion und Wahrheit oft schmerzhaft ins Gleichgewicht. Will sagen, so lange man etwas nicht selber erfahren oder getan hat, kann man es viel weniger beurteilen.
Zum Beispiel die Sache mit dem Kochen. Aufgewachsen bin ich mit einer Mutter, die Haushalt und Kinder klaglos gemanagt hat und ihre Familie täglich selbstverständlich frisch bekochte. Ihre leckeren Mahlzeiten schmecke ich noch heute. Leider hat sie viele ihrer Rezepte mit ins Grab genommen, weil ich in jungen Jahren an völlig anderen Sachen interessiert war, als an handgeschriebenen Zutaten mit Zubereitungsvorgaben. Als hungriger Konsument erhielt ich jeden Mittag von „Mutti“ einen dampfenden, randvollen Teller vorgesetzt und aß mich lustvoll schmatzend satt, bis kein Happen mehr in mich reinging. Wie und wann und mit welcher Liebe sich meine Mutter ihren vielseitigen Speiseplan ausgedacht, was sie ständig alles an Zutaten die drei Stockwerke hochgeschleppt hatte, wie viel Arbeit ihre köstlichen Gericht brauchten, was sie danach alles abwaschen und wieder in die Schränke zurückstellen musste, darüber habe ich nie nachgedacht.
Mein Mund war schließlich zum Essen da und nicht um Fragen zu stellen oder mich zu bedanken. Dieser tägliche Service war für mich Naturgesetz und ihre obligatorische Frage „Schmeckts denn?“ habe ich eher als nervig empfunden, immerhin anstandshalber aber mit „Ja-ha“ beantwortet. Damit gab sie sich zufrieden, ich sah es an ihren geröteten Wangen. Nur einmal hatte ich ihr mit „Die Kartoffeln waren ein klein wenig zu salzig“ geantwortet. Daraufhin war sie den Tränen nah, riss sich die Schürze runter und schrie: „Dann sucht euch doch eine andere!“ Ich konnte sie nur mit Mühe davon abhalten, vom Balkon zu springen. Müßig zu erwähnen, dass ich sie fortan nie wieder kritisiert habe. Gab allerdings auch nie wieder einen Grund.
Und heute nun koche ich selber. Gerne sogar. Schnüffle nach neuen Rezepten, besorge die Zutaten, schnipple, schäle, schneide, hacke, würfle, siebe, rühre, quirle, überwache meine brodelnden Kochtöpfe und Pfannen bis zum endgültigen Finale – und tische meiner Familie oder meinen Freunden geschwitzt aber glücklich auf. Irgendwann zwischen dem Klappern von Messern, Gabeln, Porzellan und Kauknochen kann ich mich nicht mehr beherrschen, bricht die Sehnsucht nach einer bescheidenen Geste der Dankbarkeit für meine hingebungsvollen Kochkünste und körperlichen Aufwendungen – von den Investitionen mal ganz abgesehen – haltlos aus mir heraus: „Schmeckt´s denn?“ In der Regel erhalte ich auf diese offensive Nachfrage ein höfliches, leicht pikiertes „Ja-ha“. Letztens aber meinte mein Ältester „Die Nudeln hätten etwas mehr Biss haben können.“ Ich hab mir sofort die Schürze vom Leib gerissen und gebrüllt: „Dann sucht euch doch einen anderen!“ Am Brückengeländer hat man mich dann wieder eingefangen.