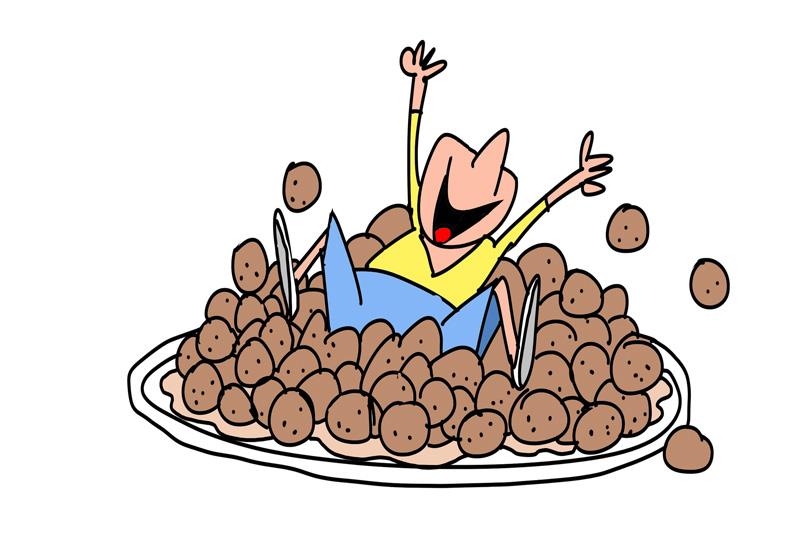
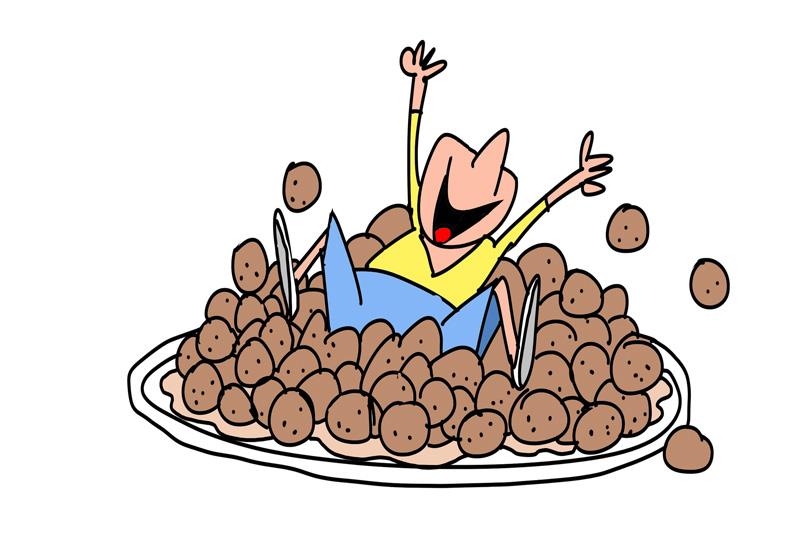
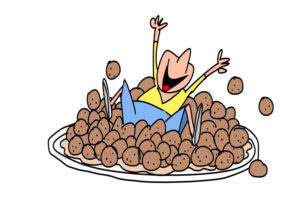 Dieter war schon ein paar Mal auf Insel, hatte sie uns wärmstens empfohlen und alles organisiert. Nun saßen wir, fünf urlaubsfreudige Freunde, nach der Ankunft mit weißen Beinen und in halblangen Hosen in einem von Dieter gepriesenem Lokal und blätterten in der Speisenkarte. Nach strapaziösen Anreisen und spärlichem Fliegerfraß habe ich grundsätzlich Riesenhunger und verspüre den drängenden Wunsch, ihn zu stillen.
Dieter war schon ein paar Mal auf Insel, hatte sie uns wärmstens empfohlen und alles organisiert. Nun saßen wir, fünf urlaubsfreudige Freunde, nach der Ankunft mit weißen Beinen und in halblangen Hosen in einem von Dieter gepriesenem Lokal und blätterten in der Speisenkarte. Nach strapaziösen Anreisen und spärlichem Fliegerfraß habe ich grundsätzlich Riesenhunger und verspüre den drängenden Wunsch, ihn zu stillen.
In meinem Bekanntenkreis eilt mir wegen dieser Neigung der Ruf eines „Fresssacks“ voraus. Was daran verwerflich ist, auf die Wünsche seines Körpers zu hören, kann ich mir nur damit erklären, dass heutzutage der Hunger in einer vom Schlankheitswahn besessenen Zeit als Feind diskreditiert wird und mit allen Mitteln, zumeist von der Pharmaindustrie, beseitigt oder zumindest gebändigt werden muss. Ich bin in einer elterlichen Welt aufgewachsen, in der satt werden das ersehnte Ziel einer hungergeplagten Nachkriegsgeneration war. „Bist du satt geworden?“ fragte mich meine Mutter nach jeder Mahlzeit ständig und wenn meine positiven Bestätigungen sie immer noch nicht zufriedenstellten, folgte ein resolutes: „Du bist doch noch nicht satt!“ Ich durfte erst aufstehen, wenn mir nachweislich schlecht war. Diese historische Komponente soll meinen folgenden Fall verständlicher machen und bei der Gelegenheit möchte ich auch noch grundsätzlich erklären, dass ich mein Brot mit jedem Armen und Hungernden teilen würde – nur nicht im Urlaub mit gutsituierten Freunden, welche sich mit dem Betreten der Insel zu meinem Erstaunen schlagartig in glühende Verehrer der insularen Küche verwandelten und zugleich Anhänger einer kollektiven Bestellung waren: gemeinsam alles essen und am Ende durch alle teilen. Diese Sozialküche steht, wie schon gesagt, in solch speziellen Momenten diametral zu meinem Individualbedürfnis.
Noch mal: ich liebe auch kulinarische Vielfalt und die kultivierte Plauderei zwischen den Gängen – aber nicht wenn ich hungrig bin! Dieter moderierte inzwischen wie selbstverständlich die Speisekarte und sagte: „Hier gibt´s nur leckere Sachen, wir essen doch von allem etwas, oder?“ Eine rein rhetorische Frage, längst war er nämlich zur Führungs-und Deutungs-Hoheit avanciert und ganz unter die Haut der Insulaner geschlüpft. Er rief den Kellner und bestellte Tapas, die mir größtenteils völlig fremd waren, wobei er beim Ordern der einzelnen Speisen weiterhin in scheinheiliger Höflichkeit „Oder?“ in die Runde fragte, um seiner Bestellung einen basisdemokratischen Anstrich zu verleihen. Niemals hätte ich es gewagt ihm mit „Ich mag aber keine Sardinen“ in die Parade zu fahren. Ergeben hörte ich ihn Gemüse und Fisch „mit schön viel Knoblauch“ in allen erdenklichen Variationen bestellen, bis mich plötzlich „Fleischbällchen in Tomatensoße“ aus meiner Lethargie rissen. Mein Magen wollte „Davon hätte ich gerne zwei Dutzend!“ schreien, riss sich aber zusammen.
Eine halbe Stunde später war unser Tisch randvoll mit kleinen Schälchen mit den verschiedensten Gerichten, über die sich nun alle hermachten. Jeder nahm sich vor meinen fressneidischen Augen etwas davon und hiervon und ständig hörte man kleine Laute des Entzückens wie „Köööstlich“ oder „Wie lecker“ oder „Delikat“. Dieter steckte keinen Bissen ohne Lobpreisung der mediterranen Küche in seinen Mund: „Leute, ihr müsst unbedingt von den Oliven in Brunnenkresse probieren, ein Gedicht!“ Mein ganzes, schlichtes Sehnen hingegen galt dem Schälchen mit den Fleischbällchen, die meiner konservativen Ansicht nach als Einzige in der Lage waren, meinen quälenden Hunger zu stillen. Als es endlich bei mir ankam, waren zu meinem Leidwesen nur noch zwei übrig. Auf meine verschämte Frage, ob wir die nicht nachbestellen könnten, meinte Dieter nur: „Aber probiere doch mal die Octopusärmchen in Senf-Koriander-Krüstchen.“
Am nächsten Abend gingen wir wieder in dieses Lokal. Bevor Dieter seine Bestellungsregie starten konnte, sagte ich laut: „Ich nehme heute mal eine große Portion von den Fleischbällchen. Nur für mich.“ Eine halbe Stunde später war ich gewaltsam in Abschiebehaft verbracht.
